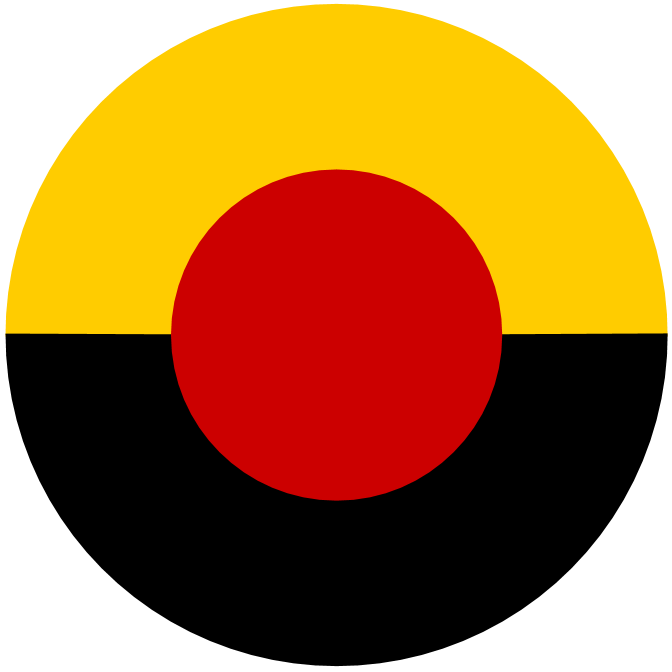Bazon Brock argumentiert, dass die Unterscheidung von Kunst und Kultur im Laufe der Zeit immer wichtiger geworden ist, da Künstler und Wissenschaftler eine Autorität durch ihre individuelle Schöpfungskraft erlangt haben, die der traditionellen Autorität von Kulturkollektiven gegenübersteht. Er kritisiert die heutige Tendenz, Künstler und Wissenschaftler wieder stärker den kulturellen Kollektiven, insbesondere dem Markt, zu unterwerfen, und plädiert für eine stärkere Betonung der Autonomie und Individualität in Kunst und Wissenschaft.

1. Was ist der Unterschied zwischen Kunst und Kultur?
Kunst und Kultur werden oft miteinander vermischt, sind aber grundlegend verschiedene Begriffe. Kultur bezieht sich auf die Gesamtheit der Lebensweisen, Traditionen, Werte und Normen einer Gesellschaft. Sie dient der Stabilität und Kontinuität und manifestiert sich in kollektiven Ausdrucksformen wie Ritualen, Religionen und sozialen Strukturen. Kultur ist also das was geworden ist, was schon besteht – Kultur ist die Perspektive der Vergangenheit.
Kunst hingegen ist Ausdruck individueller Autorschaft (Autor = Urheber, Veranlasser). Sie hinterfragt Konventionen, strebt nach Veränderung und Innovation und drückt sich durch einzigartige Werke und Erkenntnisse aus. Künstler und Wissenschaftler agieren nicht als Mitglieder einer Kultur, sondern als Individuen mit der Autorität der Autorschaft. Durch diese Autorität bringen sie selbstbestimmt etwas Neues hervor, etwas das es vorher so nicht gegeben hat – Kunst ist die Perspektive der Zukunft.
2. Warum ist die Unterscheidung von Kunst und Kultur wichtig?
Die Vermischung von Kunst und Kultur führt zu einer Verkennung der Rolle und Bedeutung von Künstlern und Wissenschaftlern in der Gesellschaft. Künstler und Wissenschaftler sind nicht nur »Kulturschaffende« im Sinne von »Verwaltern kultureller Infrastruktur«. Ihre Aufgabe ist es, durch ihre individuelle Autorschaft Innovation und Fortschritt – also Zukunft – zu ermöglichen. Die Verwechslung beider Bereiche führt dazu, dass Künstler und Wissenschaftler der Autorität des Kollektivs und den Zwängen des Marktes unterworfen werden, was ihre Freiheit und Kreativität einschränkt.
3. Wie hat sich das Verhältnis von Kunst und Kultur historisch entwickelt?
Seit dem 14. Jahrhundert, so Brock, hat sich in Europa eine neue Form der Autorität entwickelt, die sich nicht aus der Zugehörigkeit zu einem kulturellen Kollektiv ableitet, sondern aus der individuellen Schöpferkraft und dem Streben nach Innovation. Künstler und Wissenschaftler beanspruchen eine eigene Autorität, die sich aus ihrer Fähigkeit speist, über die tradierten kulturellen Muster hinaus zu denken und zu handeln.
Diese »Autorität der Individuen« steht im Widerspruch zur »Autorität der Kulturen«, die auf der Bewahrung bestehender Strukturen basiert. Künstler und Wissenschaftler hinterfragen die herrschenden Konventionen und schaffen neue Perspektiven und Möglichkeiten, die die Kultur herausfordern und verändern können.
Diese Entwicklung gipfelte im 5. Artikel des Grundgesetzes, der Wissenschaft und Kunst die Freiheit garantiert. Inzwischen droht diese Freiheit durch den Einfluss des globalen Marktes und den Druck der Kulturindustrie verloren zu gehen.
4. Welchen Einfluss hat der Markt auf das Verhältnis von Kunst und Kultur?
Der globale Markt übt einen zunehmenden Druck auf Künstler und Wissenschaftler aus, sich den Bedürfnissen der Kulturindustrie und den Wünschen der Geldgeber anzupassen. Künstlerische und wissenschaftliche Leistungen werden zunehmend nach ihrem Marktwert beurteilt, was zu einer Einschränkung der Freiheit und unter dem Primat der ökonomischen Verwertbarkeit führt.
Die zunehmende Kommerzialisierung von Kunst und Wissenschaft führt nämlich dazu, dass Künstler und Wissenschaftler gezwungen sind, sich den Erwartungen des Marktes zu unterwerfen. Sie müssen ihre Arbeit nach den Kriterien der Profitabilität ausrichten und sich an den Geschmack eines breiten Publikums anpassen. Dies kann zu einer Verflachung und Vereinheitlichung von Kunst und Wissenschaft führen und die Entstehung neuer, innovativer Ideen behindern.
Brock kritisiert die Vereinnahmung von Künstlern und Wissenschaftlern durch Institutionen wie Museen, Galerien, Universitäten und Förderorganisationen. Diese Institutionen bestimmen, welche Kunst und Wissenschaft gefördert und welcher Zugang zur Öffentlichkeit gewährt wird. Künstler und Wissenschaftler werden somit von den Geldgebern abhängig und müssen sich den Erwartungen dieser anpassen, um ihre Arbeit finanzieren zu können.
Die Dominanz des Marktes zeigt sich in der Bewertung von Kunst und Wissenschaft anhand des Preises und der Verkaufszahlen. Der »Preisdruck« wird als ein Indikator für die »ökonomische Gültigkeit« von Kunst und Wissenschaft betrachtet, wodurch die eigentliche Bedeutung und der Wert der Arbeit in den Hintergrund treten.
Brock sieht in dieser Entwicklung eine Abkehr von der europäischen Tradition der »Autorität durch Autorschaft«, in der Kunst und Wissenschaft als Ausdruck individueller Freiheit und Kreativität verstanden wurden.
5. Wie kann die Autonomie von Kunst und Wissenschaft
in Zukunft gesichert werden?
Die Sicherung der Autonomie von Kunst und Wissenschaft erfordert eine Abkehr vom Primat des Marktes und eine Rückbesinnung auf den Wert individueller Autorschaft. Ein Vorbild dafür bieten die Akademien des 17. Jahrhunderts, die Künstlern und Wissenschaftlern einen Raum für Austausch und Inspiration jenseits der Zwänge des Marktes boten.
In einer Zeit, in der die meisten Menschen Analphabeten waren und nicht lesen konnten, schufen die Akademien einen Raum für den Dialog und die Auseinandersetzung mit künstlerischen und wissenschaftlichen Ideen. Die Mitglieder der Akademien garantierten sich gegenseitig, dass jeder, der etwas sagt, auch bereit ist, den anderen zuzuhören. Dieser gegenseitige Respekt und das Interesse am Austausch waren die Grundlage für eine produktive und freie künstlerische und wissenschaftliche Arbeit.
Brock betont, dass Akademien Verbünde von Individuen sind, die sich jenseits der normalen kulturellen Zusammenschlüsse organisieren. Sie definieren sich nicht über gemeinsame kulturelle Merkmale oder Zugehörigkeiten, sondern über ihre individuelle Autorschaft und ihr gemeinsames Interesse an Kunst und Wissenschaft.
Die Akademie als Modell einer freien und autonomen Gemeinschaft könnte auch heute wieder eine wichtige Rolle spielen, um die Autorität des Individuums in Kunst und Wissenschaft zu stärken und die Freiheit des Denkens und Schaffens zu bewahren. Es geht darum, dass sich Individuen in demokratisch organisierten Gesellschaften am Beispiel der Künstler und Wissenschaftler orientieren und ihre eigene Autorität durch »individuelle Fähigkeit des Urteils« entwickeln.
6. Welche Rolle spielen Beuys und Hundertwasser
in der Diskussion um Kunst und Kultur?
Joseph Beuys und Friedensreich Hundertwasser sind Beispiele für Künstler, die sich bewusst von der traditionellen Kunstauffassung abgrenzten und stattdessen eine neue Kultur schaffen wollten. Sie ließen sich von außereuropäischen Kulturen und spirituellen Traditionen inspirieren und entwickelten eigene Ausdrucksformen, die über den Kunstbegriff hinausgingen. Ihr Schaffen zeigt die Spannung zwischen individueller Autorschaft und der Einbindung in kulturelle Kontexte.
Beuys' Ziel war es zum Beispiel nicht, Kunst um ihrer selbst willen zu schaffen, sondern das Leben der Menschen zu verbessern und die Gesellschaft zu verändern. Dabei ließ sich Beuys von kulturellen Ausdrucksformen inspirieren, die nicht der traditionellen Kunstwelt angehörten. Er bezog sich auf keltische Spiritualität, schamanistische Traditionen und die kollektiven Ausdrucksformen früherer Kulturen. Diese Einflüsse flossen in seine Kunst ein und prägten seine Vorstellung von der »Sozialen Plastik«.
Die Soziale Plastik ist ein Schlüsselbegriff in Beuys' Werk und bezeichnet die Idee, dass die Gesellschaft selbst ein Kunstwerk ist, das von allen Menschen gestaltet werden kann. Kunst ist für Beuys nicht auf Galerien und Museen beschränkt, sondern ein Prozess, der das gesamte Leben und die sozialen Beziehungen umfasst.
Beuys sah in jedem Menschen einen Künstler, der durch sein Handeln und seine Kreativität zur Gestaltung der Gesellschaft beitragen kann. Seine eigene künstlerische Arbeit verstand er als einen Beitrag zur »sozialen Skulptur« und als ein Beispiel dafür, wie Individuen die Gesellschaft positiv verändern können.
Brock beschreibt Beuys als einen Künstler, der sich bewusst von der »kollektiven Autorität der Kultur« distanzierte und die »Autorität des Individuums« betonte. Beuys lehnte die Vereinnahmung von Kunst und Wissenschaft durch die Kulturindustrie ab und plädierte für die Freiheit und Autonomie des künstlerischen und wissenschaftlichen Schaffens.
7. Wie sieht die Zukunft der Kunst und Wissenschaft
in einer globalisierten Welt aus?
In einer globalisierten Welt, die von Marktlogik und Kollektivismus geprägt ist, droht die Freiheit und Autonomie von Kunst und Wissenschaft verloren zu gehen. Die Zukunft der Kunst und Wissenschaft liegt in der Stärkung individueller Autorschaft und der Schaffung von Freiräumen jenseits des Marktes. Künstler und Wissenschaftler müssen sich als Individuen begreifen und ihre Arbeit als Beitrag zur Entfaltung einer Gesellschaft freier Individuen verstehen. Die Orientierung am Akademiegedanken des 17. Jahrhunderts, der den Austausch und die gegenseitige Unterstützung von Individuen förderte, kann ein Weg sein, die Zukunft von Kunst und Wissenschaft in einer globalisierten Welt zu sichern.
Fazit
Die Ausführungen von Brock bestätigen, wie wichtig die Arbeit mit dem Freiheitsprozess ist. Die drei Sphären des Freiheitsprozesses berühren nämlich alle von Brock genannten Aspekte:
In der Sphäre der »spirituellen Ich-Entwicklung« geht es um die Entdeckung des »Ich«, des eigenen schöpferischen Wesens, der eigenen Kreativität und Fähigkeit. Daraus ergibt sich die eigene Lebensaufgabe, die Berufung und damit auch der Beruf – durch den »Ich« der Welt etwas Neues hinzufüge. So wird der Mensch zum Künstler im von Brock genannten Sinne.
Die Sphäre des »zukunftsfähigen Wirtschaftsdenkens und des freien Geldes« klärt Fragen und zeigt Lösungen auf, wie die Gesellschaft vom Primat des Marktes und des Profits befreit werden kann. Wenn das Geld von überkommenen Vorstellungen befreit wird, dann ist es mit dem Geld eigentlich ganz einfach – es kann dann keinen Mangel an Geld geben. Damit kann die Gesellschaft auch von den Tendenzen zur Vereinheitlichung und Vermassung befreit werden.
In der Sphäre der »Unternehmensevolution« geht es um die Verwandlung von Unternehmen, von kommerzialisierten Maschinen hin zu Zentren der Freiheit und der Kreativität. Unternehmen müssen zu Orten werden, an denen Menschen als Freie und Kreative ihre Fähigkeiten einsetzen, um gemeinsam etwas Sinnvolles zu unternehmen. Das ist die von Brock vorgestellte Idee der Akademie. Die Unternehmen müssen Akademien werden. Das können sie auch, sobald der Sinn des freien Geldes begriffen worden ist, weil dann jedes sinnvolle Unternehmen finanzierbar wird.
Quelle: