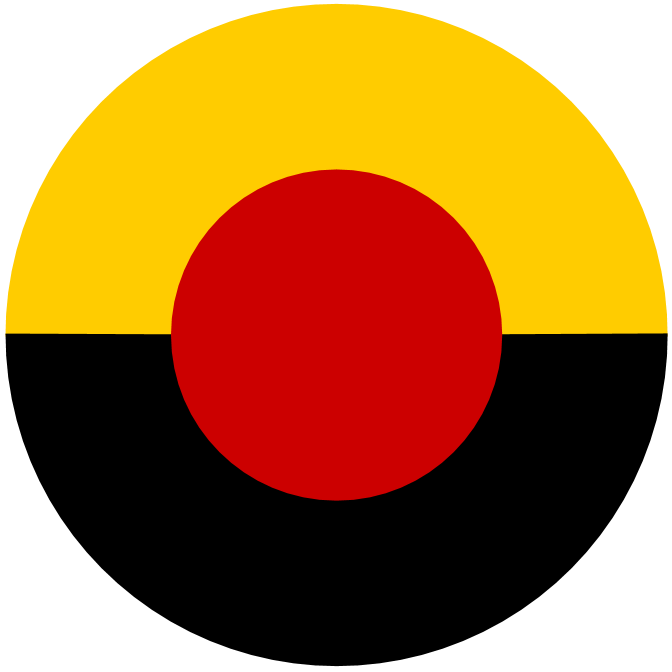Kritiker werfen gegenüber dem Freiheitsprozess oft dieselben Argumente auf: er sei zu idealistisch, zu utopisch, zu esoterisch, zu unwissenschaftlich, zu abstrakt, zu unpraktisch, und gegen die herrschenden Strukturen nicht umsetzbar. Aber, genau darum geht es im Freiheitsprozess: einen Gegenpol und eine Erweiterung zum allgegenwärtigen Realismus, den Ideologien, der Exoterik und den längst unpraktisch gewordenen und immer selben konkreten Handlungsnormen zu schaffen.

1. Der Freiheitsprozess ist viel zu idealistisch und utopisch
Um diese Kritik zu behandeln, müssen die Begriffe idealistisch und utopisch im Vergleich zu realistisch und ideologisch geklärt werden.
Als idealistisch gilt heute oft, wenn etwas als ideal, mustergültig oder vorbildlich gedacht wird, es aber eben nur gedacht und nicht gemacht wird. Der philosopische Begriff des Idealismus bedeutet, dass die Wirklichkeit in geistigen Ideen und damit zugleich im Bewusstsein des Menschen begründet ist. Hier leitet sich die materielle Welt aus dieser ideellen Welt ab, sie ist sozusagen ihr Spiegel, während die Ideen die Ursache sind.
Realismus bedeutet im Gegensatz dazu, dass es eine Wirklichkeit gibt, die unabhängig und außerhalb des menschlichen Bewusstseins existiert. Diese Wirklichkeit kann nur durch »machen«, aber nicht durch »denken« beeinflusst werden. Aber auch der Realist, kann in seinem Tun dem Idealzustand nur dann näher kommen, wenn er vorher darüber nachgedacht hat.
Eine Utopie ist ein revolutionäres Modell einer Zukunft, an die man glauben will. Das revolutionäre daran bringt es mit sich, dass auch etwas Altes für das Neue umgeworfen oder umgedreht werden muss. Daran glauben heisst, dass man noch nicht weiss, ob es klappen wird – das wird sich erst in Zukunft zeigen.
Die Ideologie ist dagegen das reaktionäre Modell einer Vergangenheit, die bewahrt werden soll. Das Gute an der Ideologie ist, dass sie Stabilität und Sicherheit herstellen will. Dafür sorgt das reaktionäre Element, das festhalten an überholten Gegebenheiten, dass aber in Fortschrittsfeindlichkeit gipfeln kann. Zu viel Ideologie verhindert dann eine mögliche bessere Zukunft, weil man immer mehr vom Selben macht, weil man meint, dass es irgendwie mal geklappt hat, aber nicht mehr darüber nachdenkt, ob es in Zukunft auch besser geht.
Die heutige Gesellschaft ist hauptsächlich von Realismus und Ideologie bestimmt und es wird zunehmend deutlich, dass man in dieser Einseitigkeit erstarrt. Und was erstarrt, das zerfällt früher oder später von selbst, um der Zukunft Bahn zu brechen. Passiert dieser Durchbruch aber unbewusst, weil man an Ideologien und Realismus festhält, dann gerät man in eine existenzielle Krise, die viel Leid verursachen kann. Klüger ist es, sich vorher schon bewusst mit Utopien und Idealismus auseinanderzusetzen, und im Wechselspiel von Ideologie und Utopie, von Realismus und Idealismus, selbstbestimmt die Zukunft zu gestalten.
Wenn das realistische Machen und Tun nicht mehr funktioniert, weil es aus ideologischen Gründen hinter der Entwicklung zurückgeblieben ist, gelingt es nur durch idealistisches Denken, auf andere, neue und utopische Ideen zu kommen, die dann zu einem Handeln führen, dass eine neue Qualität hat und neue Ergebnisse liefern kann.
2. Der Freiheitsprozess ist viel zu esoterisch
Um dieser Kritik gerecht zu werden, muss auch hier wieder eine Begriffsbestimmung vorausgehen. Esoterisch bedeutet »innerlich« oder »dem inneren Bereich zugehörig« und kommt vom griechischen Wort esōterikós (ἐσωτερικός). Im Gegensatz dazu bedeutet Exoterik, vom griechischen éxoterikós (ἐξωτερικός) stammend, dass was »äußerlich« ist.
Mit Esoterik ist oft eine Lehre gemeint, die das Innerliche, Seelische, Spirituelle betrifft. In diesem Bereich ist zugegebenermaßen viel Quatsch zu finden. Viele esoterische Bücher und Lehrer sprechen über Begriffe und Zusammenhänge, die unklar, nicht ausgereift oder nicht stimmig sind. Trotzdem ist eine sorgfältige und nach wissenschaftlicher Methode betriebene Esoterik unverzichtbar, um ein vollständiges Bild vom Menschen und von der Wirklichkeit zu erlangen.
Gegenüber der Esoterik steht die Exoterik, also die Lehren, die das Äußerliche und Körperliche betreffen. Das ist die herkömmliche Wissenschaft, die mittlerweile nur noch als Naturwissenschaft dargestellt wird. Die Naturwissenschaft heißt selbst so, weil ihr Betrachtungsgegenstand die Natur ist, womit die äußere, körperliche Welt gemeint ist. Das innerliche, seelische und geistige ist nicht ihr Untersuchungsobjekt, weshalb diese Wissenschaftsart dazu auch keine Aussagen treffen kann. Es ist absurd zu behaupten, das Esoterische sei nicht existent oder blödsinnig, weil es nicht naturwissenschaftlich zu beweisen ist. Die Naturwissenschaft kann es nicht beweisen, weil sie dort nicht hinschaut – das bedeutet aber nicht, dass es nichts Esoterisches gibt.
Zurück auf die Kritik: Ja, der Freiheitsprozess ist esoterisch, denn er versucht zu der allgemein verbreiteten Exoterik einen Ausgleich und eine Erweiterung zu finden, um zu einem vollständigen Welt- und Menschenbild zu gelangen. Das ist insbesondere für die Freiheit und die Gestaltung der Zukunft wichtig, denn beide sind ohne Esoterik unmöglich. Das Neue und das Zukünftige wird nämlich durch freies Denken vom Menschen aus seinem Inneren hervorgebracht. In einer exoterischen Welt, die allein von Physik und Naturgesetzen bestimmt ist, gibt es keinen freien Willen und nichts Neues. Alles wäre determiniert, womit auch die Zukunft vorherbestimmt wäre und nicht frei gestaltet werden könnte.
Dem Begriff der Esoterik hängt außerdem die Bedeutung an, sie sei nur für Eingeweihte bestimmt und zu verstehen. Und auch das trifft auf den Freiheitsprozess zu. Da es aber um die Freiheit geht, hat jeder die Freiheit, sich selbst einzuweihen. Die esoterischen Inhalte sind jedoch weit entfernt von den alltäglichen exoterischen Vorstellungen, weshalb diese Selbsteinweihung Mühe macht. Man muss mit seinen alten Gewohnheiten, Bequemlichkeiten und Vorurteilen ringen. Man kann nicht erwarten, dass einem die Freiheit bequem serviert wird, dass man sie nur noch aus der Verpackung reissen und konsumieren kann, so wie es bei exoterischen Themen oft der Fall ist. Freiheit ist ein individueller Prozess, von ständigen kleineren und größeren Grenzerfahrungen und Befreiungen, den es selbst durchzumachen gilt.
3. Der Freiheitsprozess ist viel zu abstrakt.
Wie soll man es konkret machen?
Ja, der Freiheitsprozess ist abstrakt, denn abstrakt bedeutet losgelöst von der Gegenständlichkeit. Die meisten Begriffe die im Freiheitsprozess bearbeitet werden, sind noch nicht handgreiflich, sie sind noch nicht als Objekt oder Gegenstand zu fassen, weil sie noch zukünftig sind. Sie sind also noch nicht da, sondern sie kommen noch. Wie ich vorher schon in Bezug auf Idealismus, Utopie und Esoterik beschrieben habe, ist aber diese andere Perspektive, diese Perspektive auf das nicht-gegenständliche, das antimaterielle, das innere, seelische und spirituelle gerade jetzt – wo das Alte an sein Ende kommt – besonders wichtig, um auf neue Ideen zu kommen.
Die Absicht des Freiheitsprozesses ist es, kreatives und selbstverantwortliches Denken in demokratischen Prozessen zu fördern. Konkrete Herausforderungen können nur von denen bewältigt werden, die vor Ort selbst damit zu tun haben – sie können eben nicht von oben herab, von Experten, Verwaltungen oder Regierungen konkret vorgegeben werden. Nur die Menschen, die in den konkreten Lebensumständen stehen, haben die Erfahrung und Kompetenz, zu konkreten Handlungen zu finden. Die ständige Forderung nach konkreten Maßnahmen und Vorschriften von oben oder von anderen, ist eine Form der Verantwortungslosigkeit und damit der Unfreiheit. Es würde der Freiheit widersprechen, wenn durch den Freiheitsprozess konkret vorgegeben würde, wie etwas zu machen ist. Der freie Mensch muss das schon selber wissen. Der Freiheitsprozess kann aber gezielt dabei helfen, das Wissen, das Bewusstsein von möglichen Handlungen zu erweitern.
4. Der Freiheitsprozess nützt mir persönlich nichts
Auf der persönlichen Ebene führt die Auseinandersetzung mit dem Freiheitsprozess zu mehr Bewusstsein, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und sittlicher Reife. Ein zentrales Thema im Freiheitsprozess ist die eigene Fähigkeit und die eigene Lebensaufgabe. Das ist die Frage, aus welchem Grund »Ich« auf diesen Planeten gekommen bin. Was will »Ich« beitragen, damit das Ganze in Zukunft besser wird.
Wer im Freiheitsprozess fortschreitet, für den wird das Interesse am Nutzen des sozialen Ganzen bald den Wunsch nach privater Nützlichkeit und Bequemlichkeit verblassen lassen. Das Wahre, Schöne und Gute zu entdecken und zu verwirklichen ist ohnehin viel interessanter, als einen finanziellen »Vorteil« zu haben oder eine »angenehme« Erfahrung zu machen.
Der persönliche Nutzen vom Freiheitsprozess ist also, dass der persönliche Nutzen in Zukunft nicht mehr so wichtig ist.
5. Der Freiheitsprozess funktioniert nicht
in der harten Realität der Wirtschaft
Die »harte Realität« der heutigen Wirtschaft, die tatsächlich unwirtschaftlich ist, lässt sich nicht leicht beschreiben, weil diese »Realität« eine schwer zu durchschauende Gemengelage ist. Als besondere Härte werden oft Wettbewerbs- und Kostendruck, Profitmaximierung, Renditezwang, Konjunkturschwankungen, Finanzkrisen, Globalisierung, Prekarisierung, Automatisierung, Anpassungsdruck, Überregulierung und Bürokratisierung, Druck von Investoren, hohe Anforderungen an Führungskräfte oder externe Kosten genannt.
In der Auseinandersetzung mit dem Freiheitsprozess wird schnell deutlich, dass all diese Schwierigkeiten Realität sind, weil sie in den Köpfen der Menschen herumgeistern. Es wird aber auch deutlich, dass diese Realität keine Wirklichkeit ist. Im Freiheitsprozess ist die Realität die äußere körperliche Welt, die durch das Handeln der Menschen hergestellt wird, und die insofern ein Ergebnis der Vorstellungen in den Köpfen der handelnden Menschen ist. Die Wirklichkeit, das, was wirklich ist, kann aber von diesen Vorstellungen abweichen, wenn sie nicht richtig begriffen worden ist. Wirklichkeit und Realität weichen vor allem dann voneinander ab, wenn man keine klaren Begriffe hat und sich deshalb in seinen Vorstellungen irrt.
Der Freiheitsprozess macht klar, dass es bei den Begriffen von Unternehmen, Arbeit, Wirtschaft, Gewinn, Investitionen, Einkommen und vor allem vom Geld heute eine große Verwirrung gibt. Diese Begriffe sind stark von überkommenen Vorstellungen aus der Zeit der Frühindustrialisierung und von unerkannten und unhinterfragten Glaubenssätzen, Ideologien und Weltanschauungen bestimmt: z.B. Profit als Unternehmensaufgabe, der Kampf um knappe Ressourcen und Märkte, die Wirtschaft als Tauschhandel, Geld als Ware, Investitionen als Spekulationsgeschäft, Arbeit als Ware, Arbeit als Selbstversorgung, Natur als Ware, der Mensch als Egoist und Homo Oeconomicus und vieles mehr.
Der Freiheitsprozess wurde entwickelt, um diese Verwirrungen zu lösen und zu wirklichkeitsgemäßen Begriffen von Geld und Wirtschaft zu kommen. Die regelmäßige Arbeit mit dem Freiheitsprozess hat gezeigt, dass sich damit ein ganz neues Bild von Wirtschaft ergibt: ein Leitbild, das nicht von Härte, sondern von Schönheit, von Freiheit, Gleichheit und Liebe bestimmt ist. Und das Beste daran ist: diese Wirtschaft ist bereits seit Jahrzehnten Wirklichkeit – es hat bloß noch kaum jemand gemerkt, weil die meisten in ihren Vorstellungen und damit in ihrer Realität gefangen sind.
Man braucht also keine großen Reformen und Umwälzungen im Außen, sondern nur eine Revolution im Inneren, nämlich in den Begriffen. Vor allem die Experten und Intellektuellen tun sich aber schwer, sich von ihren überholten Vorstellungen zu lösen – deshalb wird an Universitäten, in der Politik und in den Medien immer wieder derselbe aussichtslose Unsinn wiederholt.
6. Die im Freiheitsprozess vorgeschlagenen Lösungen, lassen sich gegen die bestehenden Machtstrukturen nicht durchsetzen
Der Versuch, sich gegen bestehende Strukturen aufzulehnen, ihnen mit Widerstand zu begegnen, gegen sie anzukämpfen, ist zwecklos – denn diese Art der »Lösung« spielt sich auf derselben Ebene ab, wie das »Problem« selbst. Das ist »altes« Denken. Das »Problem« kann nicht mit demselben Denken gelöst werden, durch das es entstanden ist. Die gewohnte Weise, bei der sich verschiedene Parteien in Diskussionen oder Auseinandersetzungen in gegensätzlichen Positionen verhärten, und darum streiten wer »Recht« hat, hat mittlerweile nur noch ein Ergebnis: die Verwirrung und damit das vermeintliche »Problem« wird größer, und meist eskaliert der Konflikt bis hin zu handfester Gewalt.
Freiheit ist aber ein ganz anderer Ort, als bloße Opposition. Im Freiheitsprozess geht es zunächst darum, sich von seinen Positionen und Gegenposition zu lösen. Persönliche Meinungen sind nicht mehr wichtig. Wenn die Lösung von Positionen, Annahmen und Meinungen anfängt, wird es möglich, eine höhere Perspektive einzunehmen, eine Superposition von der aus »Ich« das Geschehen offen und unvoreingenommen beobachten kann.
Die Superposition ist zum einen eine Metaperspektive, aus der Ich die Situation mit einer Distanz oder Höhe überblicken kann. Zum anderen ist die Superposition ein Begriff aus der Quantenphysik und bedeutet die Fähigkeit sich in mehreren Zuständen zugleich zu befinden. Ich kann in der Superposition also mehrere Positionen einnehmen ohne mich mit einer Position identifizieren zu müssen und dann mit der Gegenposition ein Problem zu kriegen.
In der Superposition, in der es weder falsch noch richtig gibt, liegt das Potenzial für ganz neues Denken und neue Lösungen verborgen. Mit der Superposition beginnt der Dialog: ein Prozess, durch den ein kreativer Geist, also das Neue, zu mir durchdringen kann. Der Dialog erfordert jedoch Geduld, Offenheit und Hingabe. Der übliche Hochmut, der so klingt wie »Ich weiss schon was richtig ist, nur die Masse der Anderen ist zu dumm«, muss der Demut weichen.
Wenn das gelingt, ist die Wirkung des Dialogs mysteriös: Denn, wenn wir Ideen durch den gemeinsamen Dialog stärken, entwickeln sie eine Wirkungsmacht, die wir nicht überschauen können – die Ideen entfalten eine metaphysische Kraft, die frei von Raum und Zeit, über sichtbare Ursache und Wirkung hinaus, auf Menschen und Situationen Einfluss hat. Wir können nicht wissen, wann, wo, wie und durch wen sich die Ideen, die wir entwickeln, verwirklichen – aber eins ist klar: Sie tun es, unabhängig von äußeren Machtstrukturen. Diese Strukturen bröckeln ohnehin an allen Ecken und Enden und zerfallen von ganz allein, wenn sie sich nicht aus eigenem Willen erneuen.