Macht der Konstruktivismus Sinn?
- Michael Plein
- 21. Sept.
- 3 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 29. Sept.

Konstruktivismus besagt, dass Wissen subjektiv konstruiert und objektive Wahrnehmung unmöglich ist. Abgesehen davon, dass diese Sichtweise sich selbst widerspricht, ist ohne allgemeine Wahrheit weder Freiheit noch Wissenschaft möglich – stattdessen müssen Positionen mit Macht durchgesetzt werden. Der Freiheitsprozess versucht dagegen, durch Dialog eine gemeinsame Einsicht in das Sinnvolle und Wahre zu erreichen, damit freiwilliges Handeln möglich wird.
Keine Ahnung von der Wirklichkeit
Konstruktivismus ist eine erkenntnistheoretische Position, die davon ausgeht, dass Wissen und Realität nicht objektiv existieren und unabhängig von unserem Denken nicht erkennbar sind, sondern vom Gehirn des Menschen »konstruiert« werden. Das bedeutet, dass wir die Welt nicht so wahrnehmen können, wie sie wirklich, ist, sondern unsere eigene Realität erschaffen, basierend auf individuellen Erfahrungen, Interpretationen und sozialen Kontexten. Das Denken wird als Konstrukteur von Scheinwelten betrachtet. Die Resalität ist immer nur eine Projektion der eigenen Vorstellungen.
Der »radikale Konstruktivismus«, vertreten von Neurobiologen wie Humberto Maturana und Francisno Varela, ist in den Sozialwissenschaften weit verbreitet. Gerd Gerken prägte in Deutschland den Fortschrittsglauben durch »Kinetisches Management«.
Steuern und Regeln machen es schlimmer
Konstruktivistische, kybernetische und systemtheoretische Ansätze widersprechen dem Freiheitsprozess, weil sie die eigene Erkenntnisfähigkeit, die Möglichkeit zur individuellen Einsicht in die Wahrheit und die moralische Fantasie verneinen. Der Glaube an den Materialismus (alles ist durch Naturgesetze bestimmt aus der Materie entstanden, auch der Geist) und den technischen Fortschritt hat im 19. und 20. Jahrhundert zu der Vorstellung geführt, man könne moralische Normen durch Zwangsvorschriften universell festlegen.
Es wurde selbstverständlich zu glauben, man könne Organisationen und Gesellschaften wie hierarchische Apparate konstruieren und durch Steuerung von oben herab regieren. Aber, je mehr man Menschen durch Gesetze und Bürokratie zum »richtigen« Handeln zwingt, umso mehr Verwirrung und Widerstand entstehen. Weder durch mehr Vorschriften noch durch mehr Maschinen, lassen sich die sozialen und ökologischen Probleme lösen – im Gegenteil: sie werden schlimmer.
Die Verwirrung der Begriffe – Geist, Intuition, Denken?
Mit den konstruktivistischen und systemtheoretischen Ansätzen entsteht eine Begriffsverwirrung in Bezug auf Geist, Intuition und Denken, weil diese meist etwas ganz anderes meinen als der eigentliche Sinn des Begriffs. Geist wird nicht als allgemeine Wirklichkeit verstanden, sondern als ein durch Sprache geschaffenes Kulturprodukt. Intuition wird nicht als spirituelles Bewusstsein, sondern als Irrationalität und Emotionalität der Psyche verstanden. Dem Denken wird unterstellt, dass es nur subjektive Konstrukte erzeugen kann, es die Wirklichkeit selbst aber nicht erkennen kann. Die komplizierte Ausdrucksweise der Konstruktivisten (Geschwurbel) weist jedoch bereits darauf hin, dass das nicht stimmen kann.
Eingeschlossen im Schädel, ist alles relativ
Die Konstruktivisten gehen davon aus, dass das Ich aufgrund seiner Neurophysiologie keine objektive Wahrnehmung von der Wirklichkeit haben kann. Alles ist verfälscht und geprägt durch die Körperlichkeit und durch »das System« der psycho-sozialen Prägung. Das Bewusstsein und sein Denken ist eingesperrt im Schädel und kann keine Gewissheit über die Wirklichkeit haben. Jeder lebt in seiner eigenen kleinen Schädelwelt, hat seine eigenen Vorstellungen, seine eigene Wahrheit – alles ist relativ. In dieser von Relativismus geprägten Welt, ist die einzige Schnittstelle nach außen die Sprache.
Diese kritische Anschauung von Wahrnehmung (Reflexion) ist in ihrer banalen und materialistischen Einseitigkeit durchaus berechtigt, aber sie betrachtet nur die Außenseite des Bewusstseins und übersieht die Innenseite, die Bedeutung des Denkens in Begriffen.
Schwerwiegender ist, dass die Behauptung, jeder hätte seine eigene Wahrheit oder alles sei relativ, in sich unlogisch ist. Denn wäre die Behauptung wahr, wäre sie selbst subjektiv und relativ und damit nicht allgemein gültig oder wahr. Damit widerspricht sich der Konstruktivismus selbst.
Ohne gemeinsame Einsicht in die Wahrheit,bleibt nur die eigenen Vorstellungen totalitär durchzusetzen
Die Anschauung der Konstruktivisten kann zum Solipsismus (allein die Existenz des eigenen Ichs ist gewiss, alles andere ist Illusion) und Totalitarismus (politischer Herrschaft mit einem uneingeschränkten Verfügungsanspruch über die Beherrschten, auch über die öffentlich-gesellschaftliche Sphäre hinaus in den persönlichen Bereich, mit dem Ziel das eigene Wertesystem durchzusetzen) führen. Wenn jedes Ich in seiner eigenen subjektiven Vorstellungswelt gefangen ist, hätte das zur Konsequenz, dass wissenschaftliche Forschung sinnlos wird, weil eine Annäherung an die Wahrheit unmöglich ist.
Der Konstruktivismus scheint demoktratisch und tolerant zu sein, weil er absolute Wahrheitsansprüche ablehnt. Ist aber alles relativ, ist keine gemeinsame Einsicht in oder Annäherung an die Wahrheit möglich, dann können eigene Auffassungen nur durch Macht und Gewalt, durch totalitäres Verhalten, durchgesetzt werden. Der Relativismus des Konstruktivismus, der absolute Wahrheitsansprüche ablehnt, ermöglicht erst totalitäres Verhalten.
Quellen
Glasl 1999 = Glasl, Friedrich: «Das Unternehmen der Zukunft. Moralische Intuition in der Gestaltung von Organisationen.», Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1999, S. 58-61, 72-77
Wilber 2005 = Wilber, Ken: »Das Wahre, Schöne, Gute. Geist und Kultur im 3. Jahrtausend«, Fischer Taschenbuch Verlagf, Frankfurt am Main 2005, S. 59
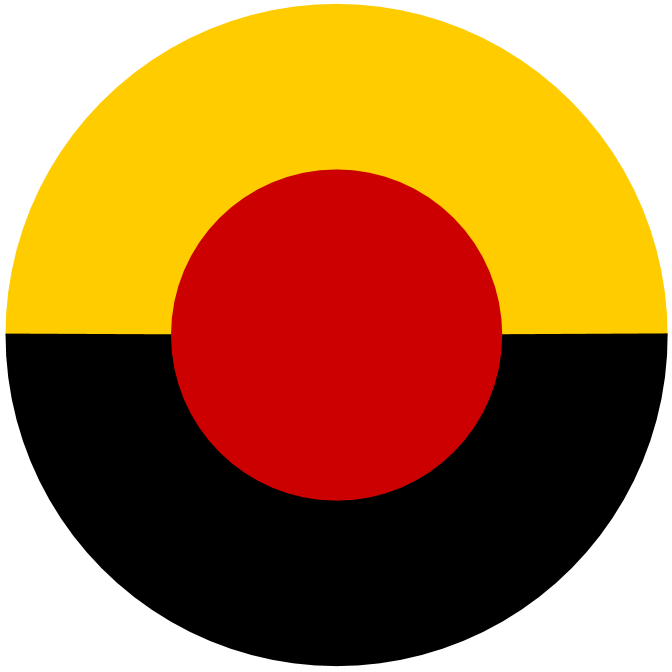



Kommentare