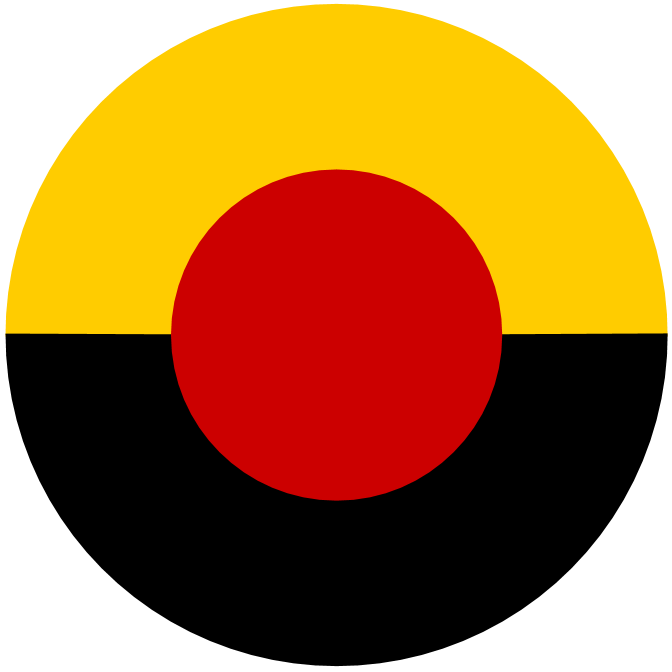Die Art, wie die meisten Leute über Geld denken und wie sie mit Geld umgehen, ist in sich widersprüchlich. Einerseits soll das Geld die Funktion als Tauschmittel, Wertmaßstab und Wertaufbewahrungsmittel erfüllen. Andererseits will man mit Geld spekulieren, man will mit Geld Geld verdienen, man will Zinsen einstreichen und Profite machen. Diese beiden Vorstellungen von den Geldfunktionen und den Geldspekulationen widersprechen sich diametral.

Geldfunktion und Geldspekulation widersprechen sich
In der modernen Wirtschaft soll Geld bestimmte Funktionen erfüllen: Es soll als Tauschmittel, als Wertmaßstab und als Wertaufbewahrungsmittel dienen. Doch wie wir mit Geld umgehen, ist von tiefen Widersprüchen geprägt: Auf der einen Seite soll Geld, stabil und frei fließend sein, um den Austausch von Wirtschaftswerten, von Produkten und Fähigkeiten, zu ermöglichen. Auf der anderen Seite steht das Streben nach Profiten, nach Zinsen und spekulativen Gewinnen, was genau diese Funktionen des Geldes erschwert oder sogar blockiert. In diesem Artikel will ich die Konflikte in unserem Umgang mit Geld anfänglich skizzieren und mögliche Wege aus dem Dilemma aufzeigen.
Geld als Tauschmittel:
Wirtschaft muss liquide sein
Um die Bedeutung von Geld als Tauschmittel zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf den direkten Tausch. Ein direkter Tauschhandel zwischen zwei Personen ist nur unter ganz bestimmten Bedingungen durchführbar: Es müssten zwei Menschen mit genau den passenden Gütern und Bedürfnissen aufeinandertreffen – zur gleichen Zeit, am gleichen Ort und mit Gütern von vergleichbarem Wert. Diese Bedingungen sind nahezu unmöglich zu erfüllen. Ein Austausch von Wirtschaftswerten wäre nur schwer möglich.
Hier kommt das Geld ins Spiel, denn das Geld als universelles Tauschmittel, löst genau diese Begrenzung auf, indem es möglich macht, dass eine Person Produkte oder Fähigkeiten in den Wirtschaftsraum hineingibt und im Gegenzug dafür Geld erhält. Das Geld ist jedoch nichts wert, sondern es symbolisiert den Wert der Produkte oder Fähigkeiten, die in den Wirtschaftsraum gegeben wurden. Damit kann die Person, die nun im Besitz des Geldes ist, zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, von einer anderen Person Produkte und Fähigkeiten beziehen. Die Beschränkung auf das Zusammentreffen von Personen, Warenwert, Bedürfnis, Ort und Zeit wird durch das Geld aufgelöst.
Das Geld ermöglicht, dass sich Wirtschaftswerte frei durch den Wirtschaftsraum bewegen können. Für eine prosperierende Wirtschaft ist es grundlegend wichtig, dass die Wirtschaftswerte beweglich sind und frei fließen können. Das Geld ermöglicht erst diesen Strom der Wirtschaftswerte, weil es ihn in Bewegung bringt und noch dazu als »fließende Buchführung« sämtliche Transaktionen im Kleinen und im Großen abbildet und somit im Bewusstsein hält. Wenn das Geld die Funktion als Tauschmittel haben soll, dann muss es frei fließen können – es muss liquide sein. Wird das Geld verknappt, zurückbehalten oder festgelegt, dann kann es nicht mehr funktionieren.
Geld als Wertmaßstab und Wertaufbewahrungsmittel:
Stabilität als Grundbedingung
Für die Funktion als Wertmaßstab und Aufbewahrungsmittel ist es entscheidend, dass es zuverlässig und stabil bleibt. Wer heute Wirtschaftswerte in den Wirtschaftsraum hineingibt und dafür Geld erhält, sollte für dieses Geld in einer angemessenen Zeitspanne wieder gleichwertige Wirtschaftswerte beziehen können. Dies erfordert, dass das Geld stets einen gleichbleibenden Wert widerspiegelt. Nur wenn diese Stabilität gegeben ist, können Menschen das Geld ohne Spekulationsdruck aufbewahren und damit wirtschaftlich sinnvoll agieren.
Spekulation und Zinsen:
Wenn Geld zur Ware wird
Doch in der Realität wird Geld nicht nur als Tauschmittel genutzt. Der Wunsch, aus Geld mehr Geld zu machen, ist zum zentralen Antrieb der breiten Masse geworden. Zinsen und Spekulation sind dafür die wichtigsten Werkzeuge – sie stehen aber im Widerspruch zu den Funktionen des Geldes.
Um Zinsen zu generieren, muss Geld knapp gehalten werden. Wäre genug Geld für die laufenden wirtschaftlichen Aktivitäten vorhanden, gäbe es keinen Anreiz, für das Leihen von Geld einen Preis zu zahlen. Geldbesitzer halten ihr Geld daher gezielt zurück, um die Knappheit zu verstärken und Zinsen einfordern zu können. In diesem System kann Geld also nur dann profitabel sein, wenn sein Fluss blockiert und somit die freie Bewegung der Wirtschaftswerte eingeschränkt wird.
Spekulation auf Geld, etwa durch Wetten auf Wechselkurse oder Investments in Gold oder Bitcoin, erfordert ebenfalls Instabilität. Denn die Gewinne spekulativer Geschäfte beruhen auf den Schwankungen der Geldwerte, und so wird ein instabiles Geld zur Bedingung für Profite. Mittlerweile ist es selbstverständlich, dass Gewinne nicht nur bei steigenden Preisen entstehen, sondern auch bei sinkenden Preisen. Je instabiler das Geld, umso mehr Sepkulationsgewinne lassen sich erzielen.
Kreditgeld und Zinsen:
Das Dilemma moderner Geldschöpfung
Heutzutage entsteht der Großteil des Geldes als Kredit durch Zentral- und Geschäftsbanken. Dieses Kreditgeld ist nur zu einem geringen Anteil durch reale Werte, wie Gold, Wertpapiere oder Einlagen gedeckt. Der größte Teil des Kreditgeldes wird in der Buchhaltung neu geschöpft, indem Zahlen in einen Computer eingegeben werden. Dieser Vorgang ist an sich betrachtet genau richtig, wenn die Menge des neu geschaffenen Geldes auch den Wirtschaftswerten (Fähigkeiten und Waren) entspricht, die von denen, die einen Kredit erhalten, hergestellt werden sollen.
Jetzt ist es im herrschenden Geldsystem so, dass dieser Kredit mit Zinsen belastet wird. Das heisst, am Ende muss mehr Geld zurückgezahlt werden, als vorher herausgegeben wurde. Dieses mehr an Geld ist aber im Wirtschaftskreislauf nicht vorhanden. Diese Situation erzeugt wieder eine Knappheit von Geld, was Zinsen und damit Preise steigen lässt und das Geld instabil macht.
Desweiteren ist zu bedenken, dass die Zinsen auf die Kredite, auf den gesamten Wirtschaftsraum betrachtet, niemals zurückgezahlt werden können, weil dieses Zinsgeld nicht geschöpft wurde. Das bedeutet, die entstandenen Schulden, müssen nach Ablauf der jeweiligen Kredit-Zeiträume erneut kreditiert und verzinst werden. Damit werden Zinsen auf Zinsen bezahlt, was über kurz oder lang zu einem exponentiellen Anstieg der Schulden führt.
Die Schulden des einen sind dabei immer die Vermögen des anderen. Das bedeutet auch die Vermögen steigen exponentiell an. Sie steigen aber nur bei den Wenigen an, die im Besitz von mehr Geld sind, als sie für ihren eigenen Konsum, für ihre eigenen Bedürfniserfüllung benötigen. Dieses zuviel an Geld können die Geldbesitzer gegen Zinsen verleihen. Die im Zinseszins eingebaute Exponentialfunktion sorgt dafür, dass das Geld mit wachsendem Tempo und wachsender Ungleichheit von denen die für ihr Geld arbeiten, zu denen die ihr Geld angeblich für sich arbeiten lassen, umverteilt wird.
Langfristig steigert dies die Ungleichheit im Wirtschaftssystem, da diejenigen, die bereits Vermögen besitzen, von der Zinsstruktur profitieren, während jene, die Geld für ihren Lebensunterhalt brauchen, dieses zunehmend schwerer erlangen können. Die Zinseszinsmechanik verstärkt diese Dynamik noch weiter, indem sie einen exponentiellen Anstieg der Schulden auf der einen Seite und der Vermögen auf der anderen Seite bewirkt.
Ein Weg aus dem Widerspruch:
Geld als Bewusstseinsmedium statt Ware
Um diese grundlegenden Widersprüche aufzulösen, muss das Verständnis von Geld hinterfragt werden. Solange Geld als Ware betrachtet wird, die Profite durch Zinsen und Spekulation abwerfen soll, wird es immer wieder zu Krisen und Knappheiten kommen. Wird das Geld von den Phantasmagorien der Spekulanten befreit, kann es als universelles Tauschmittel und Wertsymbol frei fließen und den wirtschaftlichen Austausch fördern – ohne Knappheit, Starrheit, Unbeweglichkeit oder Instabilität zu erzeugen.
Dazu muss man sich selbst fragen, ob man für ein freies Geld nicht auf Spekulationen verzichten kann. Wird das Geld richtig und zukunftsfähig gedacht, wird ohnehin schnell deutlich, dass es keinen Mangel an Geld geben kann – es entsteht ja in der Buchhaltung. Jedes sinnvolle Unternehmen ist finanzierbar und jeder Mensch kann ein gerechtes Einkommen für die optimale Erfüllung seiner individuellen Bedürfnisse bekommen. Fängt man an das zu denken, dann ist es logisch, dass niemand Spekulationen, Zinsen und Profite braucht.
Das Geld als Ware zu betrachten, mit der man handelt und Geld verdient, ist ein Anachronismus (ewiggestrig, fortschrittsfeindlich, gegen jegliche Neuerung, im Gestern lebend, nicht in der Gegenwart angekommen, reaktionär, rückschrittlich, zurückgeblieben) aus der Zeit der Frühindustrialisierung. Diese Vorstellung, die das Grundmotiv des Kapitalismus ist, steht im totalen Widerspruch zu dem, was das moderne Geld eigentlich sein will: ein Bewusstseinsmedium und ein Fließmittel für eine blühende, fortschrittliche, wirtschaftliche, nachhaltige Wirtschaft, in der sich Produkte und Fähigkeiten frei und angemessen bewegen können. Eine Wirtschaft, in der sich die Wirtschaftsprozesse ungehindert und ohne den Einfluss von undemokratischen Machtstrukturen, entfalten können. Eine Wirtschaft und ein Geldwesen, dass zum Ziel hat, die Fähigkeiten, also das Potenzial und die Kreativität der Menschen bestmöglich zu entfalten und auf die Erde zu bringen, sie also auch zu Verwirklichen.
Fazit:
In einem zukunftsfähigen Geldswesen würde Geld als bewusstes und freies Werkzeug für wirtschaftlichen Austausch dienen. Es würde nicht mehr durch Spekulation und Zinsen gebremst, sondern würde allen Menschen den Zugang zu den wirtschaftlichen Werten sichern, die sie für ihre Bedürfnisse benötigen. Ein solches Geld hätte das Potenzial, soziale und wirtschaftliche Ungleichheit abzubauen und eine Wirtschaft zu schaffen, in der Kreativität, Potenzial und individuelle Fähigkeiten frei entfaltet werden können.