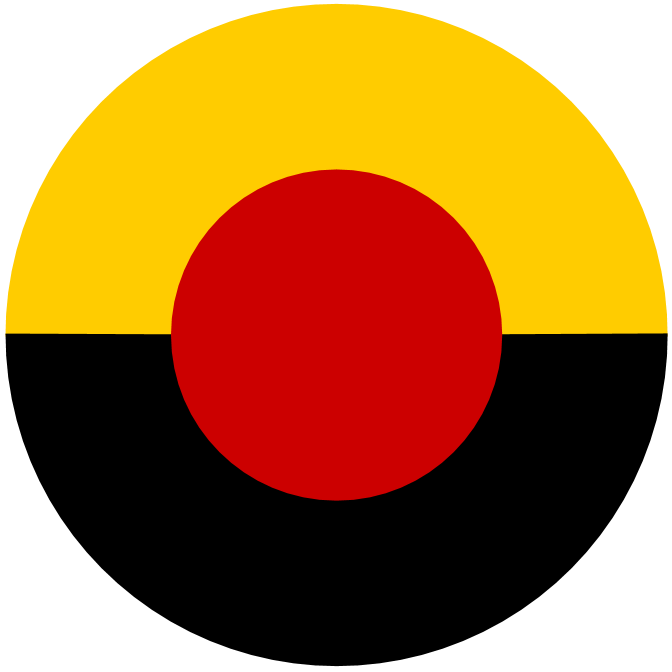Freiheit und Grenzen sind eng miteinander verwoben, besonders in einer Welt, die wir oft als materiell begrenzt betrachten. Immanuel Kant, der Aufklärungsphilosoph, verstand die Realität materialistisch und rational, frei von übernatürlichen Einflüssen. Diese Perspektive legt nahe, dass Freiheit nur im Rahmen begrenzter Ressourcen möglich sein kann. Doch unser kreatives Potenzial ermöglicht es, über diese Beschränkungen hinauszudenken und die Grenzen des Materiellen zu überwinden, um neue Freiräume zu schaffen.

Materialismus und Begrenztheit
Wenn es um Freiheit geht, wird immer wieder gern das Zitat »Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt.« gebracht. Dieses Zitat stammt von Immanuel Kant.
Kant war ein deutscher Philosoph in der Zeit der Aufklärung – er wurde 1724 geboren. [1] Er hat als einer der ersten den Versuch unternommen, das wissenschaftliche Denken von religiösen Vorstellungen und theologischen Gesichtspunkten zu befreien. Kant wollte die Realität allein durch sein logisch-rationales Denken verstehen, ohne von im Hintergrund wirkenden mythischen und magischen Kräften abhängig zu sein – davon wollte er frei sein.
Durch den Ausschluss religiöser Aspekte, hat er die Grundlagen für das heute bekannte naturwissenschaftliche Denken gelegt. [2] Im Grunde ist dieses naturwissenschaftliche Denken ein materialistisches Denken. Mit »materialistisch« ist aber hier nicht gemeint, dass jemand auf teure Uhren oder schnelle Autos steht. Materialismus ist ein philosophisches Konzept, dessen Grundannahme ist, dass die Realität oder die Natur nur aus Materie besteht. Demzufolge gibt es keinen Gott oder Geist – alle psychischen und spirituellen Phänomene sind dann bloße Nebenwirkungen der Materie.[3]
Solche Grundannahmen, auch Axiome genannt, sind der notwendige Anfang jeder wissenschaftlichen Theorie. Ein Axiom ist ein als wahr angenommener Grundsatz.[4] Es ist wichtig, dass »Ich« (das großgeschriebene Ich bedeutet den kreativen Wesenskern des Menschen) mir im Klaren bin, dass Axiome innerhalb einer Theorie nicht beweisbar sind. Das bedeutet das Axiom »Es gibt nur die Materie«, kann nicht bewiesen werden.
Realismus und Anpassung
Wenn Ich mir die Realität auf Grundlage des Materialismus-Axioms erkläre, kann Ich leicht zu der Schlussfolgerung kommen, dass die Welt fertig ist. Mit »fertig« ist gemeint, dass wir nur über eine bestimmte Menge an Material und damit auch an Ressourcen und Möglichkeiten verfügen, und dass die Dinge von den Naturgesetzen beherrscht werden und deshalb so ablaufen, wie sie ablaufen.
Das ist umso mehr der Fall, seitdem die Naturwissenschaft festgestellt hat, dass unsere Erde ein Planet ist, der durch die unendlichen Tiefen des Weltalls saust. Dieser Planet, diese Steinkugel ist ganz klar begrenzt – unser Lebensraum endet in den oberen Schichten der Erdatmosphäre [5] und dann kommt erstmal lange nichts – und zwar ein dunkles kaltes lebensfeindliches Nichts.
Daraus folgt: Der Planet – und damit die Realität, in der wir existieren müssen – ist uns gegeben, die Menge an Ressourcen und Materie ist begrenzt, die Regeln nach denen alles Abläuft sind durch Physik-Formeln festgelegt – da können wir als Menschen nichts dran machen. Wir müssen uns an die gegebene Situation anpassen.
Freiheit mit Grenzen ist unlogisch
Wenn die ganze Welt begrenzt und vorherbestimmt ist, dann scheint es nur logisch zu sein, dass auch die Freiheit begrenzt ist – und wenn die Freiheit begrenzt ist, dann endet meine Freiheit dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Dann müssen wir die Territorien der eigenen Freiheit abstecken und diese verteidigen, denn die Bevölkerungsdichte und die Einzelinteressen scheinen ja zu wachsen, während die Menge an Welt und damit das Ausmaß, in dem (sog.) »Interessen« befriedigt werden können, feststeht. Je mehr Freiheit einer hat, umso weniger bleibt für die anderen übrig.
Um zu verstehen, dass die Idee der Freiheit frei von Grenzen sein muss, muss Ich kein Optimist, Spinner oder Idealist sein, dazu reicht schon logisches Denken: Wenn die Freiheit begrenzt wäre, dann wäre sie logischerweise keine Freiheit. Im Wesen der Freiheit liegt nämlich, dass sie keine Grenzen hat. Eine Grenze ist ein Ausdruck von Unfreiheit. Die Freiheit – genauer gesagt die Idee der Freiheit – ist frei von Grenzen.
Damit ist nicht gemeint, dass Ich nicht auch im Feld der Realität immer wieder an meine Grenzen stoße würde. An einem solchen Punkt, an einer solchen Grenze habe Ich aber die Freiheit, meine Idee von der Realität zu erweitern. Ich kann der Realität durch »Kreativität« etwas neues hinzufügen und damit die Grenzen meiner realen Welt, also meiner bisherigen Wirklichkeit, erweitern.
Freiheit und Kreativität
Ein tolles Beispiel für die kreative Fähigkeit des Menschen, etwas ganz Neues zu erschaffen und damit die Realität zu erweitern, ist die Geschichte vom meterhohen Pferdemist in der Stadt New York. Im Jahr 1850 prognostizierten Stadtplaner, dass die Straßen New Yorks wegen der Zunahme des Kutschenverkehrs bis zum Jahr 1910 in meterhohem Pferdemist ersticken würden. Bis zur dritten Etage der Wolkenkratzer sollte sich Pferdedung stapeln. [6, 7]
Diese Stadtplaner waren sicher sehr gut in ihrem Job und haben die ihnen zur Verfügung stehenden empirischen Daten in die Zukunft hochgerechnet. Sie haben ihre Realität analysiert und die Zukunft aus den Erfahrungen der Vergangenheit abgeleitet. Womit sie aber wohl nicht gerechnet haben, war die Kreativität einzelner Menschen, durch die sich die Zukunft plötzlich ganz anders gestalten kann.
Im Jahre 1886 erbaute Carl Benz in Mannheim seinen »Patent-Motorwagen Nummer 1«. Damit war das Problem mit dem meterhohen Pferdemist in New York bis zum Jahr 1910 gelöst.[8] Die Erfindung des Automobils konnte nun ganz ohne Pferde, mehr an Personen und Gütern durch die Stadt transportieren, als es sich die Stadtplaner im Jahr 1850 vorstellen konnten.
Dieses Beispiel zeigt, wie wir oft vor lauter Realismus immer wieder das Zutrauen in unsere Kreativität und Schöpferkraft vergessen. Heute ist es ja nicht der Pferdemist, der in den Innenstädten zum Problem wird, sondern die Abgase der Motorwagen, die Carl-Benz damals erfunden hat. So wie man damals die Emissionen der Pferde hochgerechnet hat, werden heute die Emissionen der Verbrennungsmotoren hochgerechnet. Wieder wird von den Experten die Realität der Vergangenheit in die Zukunft extrapoliert und das Ergebnis erscheint als ein riesiges unlösbares Problem – eben ein riesen Haufen Mist.
Empirie oder Evidenz – es kommt auf die Zukunft an!
Man kommt oft zu einem riesen Haufen Mist, wenn man die Zukunft ausschließlich aus der Empirie, also aus der Erfahrung und den Daten der Vergangenheit ableitet. Aber die Zukunft ist nicht die bloße Ableitung der Vergangenheit. Wir sind nicht die Knechte der Vergangenheit, sondern die Schöpfer unserer Zukunft.
Und auf die Zukunft kommt es an, denn die liegt noch vor uns. Es geht nicht um die Verlängerung des Erfahrenen. Nur ein Bürokrat – auch Manager genannt – handelt aus der Vergangenheit heraus. Als unternehmerisch veranlagter Mensch, als jemand der etwas für die Zukunft unternehmen will, fange Ich immer wieder neu an. Ich handle auf der Grundlage der Fähigkeiten, die Ich in der Vergangenheit entwickelt habe und führe mein Projekt, mein Unternehmen, durch Kreativität aus der Zukunft in die Zukunft. Mit realistischen Betrachtungen aufgrund empirischer Daten erfasse Ich bloß die Vergangenheit, durch Evidenz – das ist kreative Erkenntnis – bewältige Ich die Zukunft. [9, 10]
Die eigene Zukunft bestimme Ich selbst, indem Ich kreativ werde und ganz neue Ideen entwickle. Kreativität ist die Fähigkeit etwas Neues zu erschaffen, etwas, das es vorher nicht gab. Das beginnt erstmal mit einer wagen Idee, einer Ahnung, einem Einfall – vielleicht mit einer Spinnerei oder Sepkulation. Es erfordert dann aber viel Arbeit, eine gute Idee so weit zu entwickeln, bis Ich sie verwirklichen kann – dann aber ist die Wirklichkeit erweitert.
Kreatives Denken ist raumfrei und zeitfrei
Kreativität findet in meiner geistigen Innenwelt statt. Damit ist nicht das Geisitge im Sinne von mental, rational oder intellektuell gemeint, sondern im Sinne von spirituell und metaphysisch. Dieses geistige Feld des eigenen kreativen Denkens ist weder durch Raum noch durch Zeit begrenzt. Es ist raumfrei und zeitfrei und damit auch frei von Grenzen. Ich kann mich im Denken an jeden Zeitpunkt und jeden Ort in der Vergangenheit und auch in der Zukunft versetzen – sofort und jederzeit. Historiker oder Science-Fiction-Autoren machen das hauptberuflich.
Ich erlebe diese denkerischen Raum- und Zeitreisen aber auch ganz alltäglich, zum Beispiel wenn Ich mich erinnere, was Ich gestern oder vor einem Monat getan habe – das ist eine Reise in die Vergangenheit an jeweils die Orte auf die Ich mich konzentriere.
Die denkende Zukunftsreise ist aber genauso selbstverständlich, wenn Ich mir zum Beispiel vorstelle, was Ich morgen vorhabe, und was Ich wann und wo erledigen will. Dann begebe Ich mich in Gedanken bereits zu den jeweiligen Zeiten und Orten und stelle mir vor, was Ich dort tun werde.
Warum sollte diese Gedankenkraft auf morgen oder meinen Schreibtisch oder überhaupt irgendwie begrenzt sein?
Fazit
Letztlich zeigt die Erfahrung, dass die Erfahrung nicht so wichtig ist, weil sich scheinbar unüberwindbare Probleme oft durch kreative Denkansätze und neue Ideen lösen lassen – wie im Fall des Pferdemists in New York. Auch heute stehen wir vor Herausforderungen, die uns immer mehr zum Umdenken und Weiterdenken zwingen, seien es Realitäten wie der Klimawandel, die Wirtschaftskrise oder die Ressourcenknappheit.
Doch die Freiheit, die wirklich zählt, ist die Freiheit, unser Denken über bestehende Begrenzungen hinaus zu entwickeln und neue Möglichkeiten zu entdecken. Unsere Kreativität ist nicht an die Beschränkungen der materiellen Welt gebunden; sie eröffnet uns einen Raum, in dem wir unendlich viele Ideen und Lösungen finden können. So bleibt uns die Freiheit, die Welt durch unsere Denkbewegungen und Schöpfungskraft immer wieder neu zu gestalten – weit über die Grenzen des Bestehenden und bisher Vorstellbaren hinaus.
Quellen:
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
[2] Auf das Evolutionsschema bezogen, steht der Name Kant wohl eher für den Wissenschaftskritiker, der versucht, das Denken von den Schlacken der abendländischen Metaphysik zu befreien. Er steht hier für den Naturwissenschaftler, der, von Rene Descartes einmal abgesehen, als erster unter Ausschluß theologischer Gesichtspunkte eine wissenschaftliche – Beuys würde sagen materialistische – Theogonie und Kosmologie vertritt.
Zumdick 2001 = Zumdick, Wolfgang: «Der Tod hält mich wach. Joseph Beuys – Rudolf Steiner. Grundzüge ihres Denkens.», Pforte Verlag, Dornach / Schweiz 2001, S. 116
[3] »Grundannahme materialistischen Denkens: es gibt kein geistiges Prinzip, auf das die Wirklichkeit zurückgeführt werden kann; die Materie und ihre Wirkweise ist die Ursache des Lebendigen wie des Nicht-Lebendigen; sobald die Wirkweise der Materie erkannt ist, ist auch die Wirklichkeit erkannt.«
Küpper 2017, S. 13
[4] »Ein Axiom (von griechisch ἀξίωμα: „Wertschätzung, Urteil, als wahr angenommener Grundsatz“) ist ein Grundsatz einer Theorie, einer Wissenschaft oder eines axiomatischen Systems, der innerhalb dieses Systems nicht begründet oder deduktiv abgeleitet wird.«
https://de.wikipedia.org/wiki/Axiom
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Erdatmosphäre
[6] »London im Jahre 1894. Die Zeitung „The Times“ sagt voraus, dass bis 1950 die Straßen der Innenstadt mit einer drei Meter hohen Mistschicht bedeckt sein werden. Auch in New York zeichnete ein Kolumnist das Bild eines 21. Jahrhunderts, in dem Pferdeäpfel bis zum dritten Stock der neuen Wolkenkratzer reichen werden. 1898 tagte in New York eine internationale Konferenz zur Lösung des Problems.«
https://www.tips.at/nachrichten/steyr/wirtschaft-politik/412718-vom-pferdemist-zur-digitalisierung
[7] »Um 1850 prognostizierten Stadtplaner, dass die Straßen New Yorks wegen der Zunahme an Kutschen bis zum Jahr 1910 in meterhohem Pferdemist ersticken würden. Die Geschichte strafte ihre Voraussage Lügen.«
https://www.spiegel.de/geschichte/peinliche-prognosen-a-950117.html
[8] »Der Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 ist das erste von Carl Benz erbaute Automobil mit Verbrennungsmotor. Das Patent für dieses Dreiradfahrzeug wurde von Benz am 29. Januar 1886 eingereicht und als DRP Nr. 37435 am 2. November 1886 erteilt. Am 3. Juli 1886 führte Benz die erste öffentliche Probefahrt mit dem Unikat in Mannheim durch. Er gilt als der erste praxistaugliche Kraftwagen der Welt und setzt somit die Geburtsstunde des modernen Automobils.
https://de.wikipedia.org/wiki/Benz_Patent-Motorwagen_Nummer_1
[9] »Denn bei allem, was wir tun: Worauf kommt es dabei an? Auf die Zukunft! Und eben nicht auf die Verlängerung ds Erfahrenen. Nur ein Bürokrat handelt aus der Vergangenheit heraus. Der untermehmerisch veranlagte Mensch fängt immer neu an. Er handelt auf Grundlage von heute und dem, was er aus der Zukunft antizipiert – gestärkt mit den Fähigkeiten, die er in der Vergangenheit entwickelt hat. Mit der Empirie erfasst man die Vergangenheit, mit der Evidenz bewältigt man die Zukunft.«
Werner 2014 = Werner, Götz: «Womit ich nie gerechnet habe. Die Autobiographie», Econ / Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014, S. 13
[10] »Manche Unternehmen, die erfolgreich gestartet sind, gehen daran zugrunde, dass sie diesen Schritt versäumen. Viele Pioniere glauben, dass sie mit ihren bisherigen Fähigkeiten auf Dauer erfolgreich bleiben könnten. Sie handeln aus Empirie: Ich war in der Vergangenheit erfolgreich, ich werde es auch in Zukunft sein. Sie wollen reproduzieren. Sie schauen zurück (auf ihre Erfolge der Vergangenheit) und gehen vorwärts (in eine ungewisse Zukunft). Und dann, weil sie eben nicht sehen, wohin sie gehen, fallen sie in den Graben. Solches Handeln aus Empirie ist töricht: Wenn sich die Verhältnisse ändern, braucht man andere Fähigkeiten, um erfolgreich zu sein. Denn das Verhalten der Vergangenheit hat zwar zum Erfolg geführt; aber daraus hat sich eine neue Situation ergeben - und damit auch neue Herausforderungen. Denen aber kann man, um den berühmten Physiker Albert Einstein zu zitieren, nicht mit dem Denken von gestern begegnen, das ja erst zu den Problemen von heute geführt hat. Deswegen braucht man eine Veränderung, einen Zuwachs an Fähigkeiten. Und das heißt Zuwachs an Bewusstsein. Im Klartext sagte ich mir: »Junge, du musst was lernen!«
ebd. S. 56