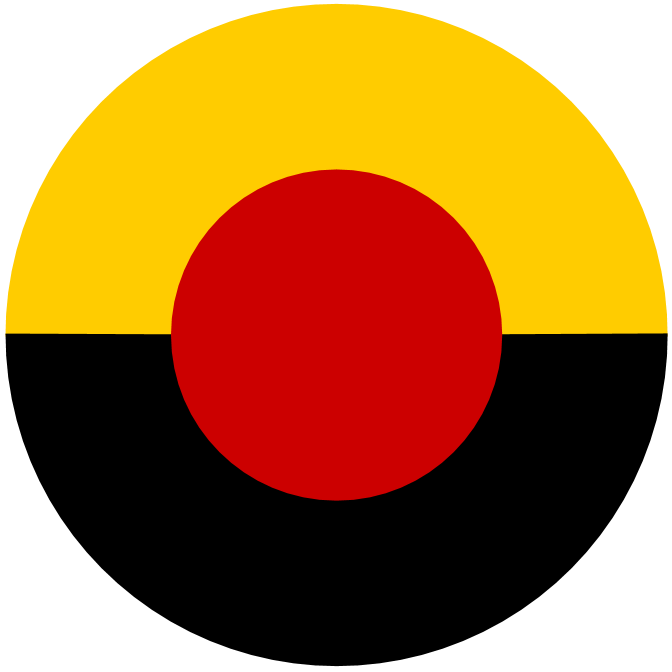Es gibt drei unscheinbare, aber mächtige Triebe, die unser soziales Leben stören: (1) Wir fühlen uns von anderen gestört oder stören selbst, (2) wir wollen andere nach unserem Geschmack verändern, und (3) wir neigen dazu, andere zu belehren. Durch diese antisozialen Triebe entsteht viel Streit, Frustration und Unfreiheit. Doch was wäre, wenn wir diese Muster durchschauen und durch gezielte soziale Gegenimpulse lösen?

1. Störungen mit Geduld und Demut begegnen
Der erste antisoziale Trieb betrifft das Wollen und Handeln (leibliche Ebene): Alle Menschen, die was tun, sind immer in der Gefahr, ihre Mitmenschen zu stören oder zu verärgern. Das ist ein ganz normaler Aspekt des Tätigseins! Wenn Ich die Initiative ergreife und zur Tat schreite, muss Ich damit rechnen, dass Ich andere Leute verärgere. Und andererseits muss Ich selbst damit rechnen, dass andere Leute mich verärgern, einfach weil sie etwas tun.
Der Soziale Gegenimpuls hierzu sind Verzicht, Geduld und Demut (intiuitive Ebene): Wenn Ich diesem ärgerlichen Treiben etwas Soziales entgegnen will, und Ich es so tun will, dass sich möglichst wenige Menschen davon gestört fühlen, dann muss es für die anderen möglichst akzeptabel, hilfreich, nützlich und sinnvoll sein. Das erfordert Verzicht und Geduld, denn man muss seine Erwartungen und Vorstellungen immer wieder zurücknehmen. Manchmal muss man auch Jahre und Jahrzehnte lang warten und es immer wieder versuchen – bis aus der Sache selbst etwas entsteht. Ich muss also warten können, bis etwas reift, bis der richtige Ort und die richtige Zeit gekommen ist – dabei geht es um Entwicklung und Reife.
Der antisoziale Trieb im Willen fordert mich zur Demut heraus. Ich muss mir bewusst machen, dass Ich es mit ganz unterschiedlichen Individualitäten zu tun habe. Demut in diesem Zusammenhang bedeutet, sich der potenziellen Auswirkungen des eigenen Handelns auf andere bewusst zu sein und nicht von der eigenen Wichtigkeit oder dem eigenen Vorhaben so überzeugt zu sein, dass die Bedürfnisse oder Befindlichkeiten anderer ignoriert werden. Demut ermöglicht eine akzeptierende Haltung gegenüber der Tatsache, dass Menschen, die im irdischen Tätig sind, sich gegenseitig stören müssen.
Kurz gesagt: Oft ärgere Ich mich über das, was andere tun und darüber, dass das was Ich tue andere ärgert – statt zu erkennen das es beim Tun immer zu Störungen kommt, die sich nur lösen lassen, indem Ich versuche mit jahrzehntelanger Geduld, Demut, Reifung, Tugend, Toleranz und Andacht das zu tun, was anderen hilft.
2. Statt andere zu Verändern, das Ich und Ich entdecken
Der zweite antisoziale Trieb betrifft das Fühlen (emotionale Ebene): Er zeigt sich in dem Wunsch, andere verändern zu wollen. In diesem Fall benutze Ich den anderen als Projektionsfläche für meine Befindlichkeiten und Geschmäcker. Oft ist es so, dass Ich so bleiben will wie Ich bin, und versuche, dem anderen »meins« überzustülpen, ihn zu erziehen, an ihm rumzumachen, damit Ich mich nicht ändern muss. Die anderen haben aber das Recht so zu sein wie sie sind und deshalb muss Ich mich so verändern, dass Ich mit ihnen klar komme, statt enttäuscht zu sein, wenn andere nicht so sind wie ich es mag. Es gibt nichts besseres als diese Ent-Täuschung, denn sie bedeutet frei zu werden von der Täuschung, von meiner Projektion.
Der soziale Gegenimpuls hierzu ist das Ich des anderen und mein Ich zu entdecken (inspirative Ebene): Das bedeutet, mit anderen Menschen offen umzugehen, zu erwarten, dass sie ganz anders sind als Ich es möchte. Es bedeutet, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist und daraus das Beste zu machen. Das Beste wäre, dass Ich der Wahrheit – dem »Ich« – des anderen näher komme. Dann kann Ich mich einigermaßen sozial verhalten, weil Ich den anderen so nehme wie er ist und nicht so wie Ich bin. Mit jeder emotionalen Verstimmung im Gefühlsverkehr mit anderen Menschen ergibt sich damit eine neue Chance, mein eigenes »Ich« zu entdecken. Ich kann anfangen damit aufzuhören, den anderen zu manipulieren oder ihn so zu formen, wie Ich ihn gerne hätte – stattdessen versuche Ich mich zurückzunehmen und an mir selbst zu arbeiten. So werde Ich am Du, also am Ich des anderen, zum Ich.
Kurz gesagt: Ich nehme den anderen als Projektionsfläche für meine Emotionen und Geschmäcker, und bin dann enttäuscht, wenn er anders ist als ich es mag – statt mich zurückzunehmen, an mir selbst zu arbeiten, aufzuhören am anderen rumzumachen und ihn so zu nehmen wie er wirklich ist.
3. Den anderen unterrichten, statt ihm beim Denken zu helfen
Der dritte antisoziale Trieb betrifft das Denken (mentale Ebene): Er bedeutet die Gefahr, den anderen von den eigenen Vorstellungen überzeugen zu wollen. Aber es geht auch anders herum: das ich mich gerne von der Position des anderen überzeugen lasse. In Diskussionen geht es oft darum, einzelne Widersprüche und Fehler zu suchen, um dann alles, was der andere sagt, für falsch zu erklären – und ihn letztlich von meiner Position zu überzeugen. Der Alltag ist heute voll von Versuchen, andere Leute Aufzuklären, ihnen Vorschriften zu machen, sie zu Belehren, ungefragt zu Beraten, zu Moralisieren oder die eigene Meinung als selbstverständlich und unhinterfragbar zu erklären.
Der soziale Gegenimpuls ist das »ins Denken helfen« (imaginative Ebene): Sozial wäre es, die eigenen Ideen so zu formulieren, dass dem anderen die Freiheit gelassen wird, diese aufzunehmen und sie eigenständig zu denken, wenn Interesse besteht. Es geht darum, es dem anderen zu überlassen, ob ihm etwas einleuchtet oder ob er es sich klar machen kann. Soziale wäre es, »so zu reden, dass der andere sein eigenes aus eigenem findet«. Außerdem geht es darum, nicht autoritätsgebunden (»Der Experte hat gesagt...«, »In diesem Buch steht aber...«) zu argumentieren, sondern dem anderen zu ermöglichen, eigene Gedankengänge zu vollziehen.
Kurzform: Ich meine den anderen überreden, beraten, aufklären oder unterrichten zu müssen – stattdessen sollte Ich meine Ideen so formulieren, dass Ich dem anderen die Freiheit lasse, selbst zu Denken und eigene Einsichten zu gewinnen.
Dreigliederung des sozialen Organismus als Leitbild
Wer das alltägliche Geschehen genauer beobachtet, wird bemerken, dass die oben genannten drei antisozialen Triebe sehr oft am Werke sind. Eine weitere Lösung dieses antisozialen Treibens ist es, die Perspektive vom kleinlichen und privaten Alltag auf die Weltgesellschaft als ein dreigliedriges organisches Gemeinwesen zu wenden. Die »Dreigliderung des sozialen Organismus« bedeutet, das gesellschaftliche Leben in drei lebendig miteinander wirkende Felder zu unterscheiden und zu gestalten: Geistesleben (Kultur, Bildung, Wissenschaft), Rechtsleben (politisches und staatliches Leben) und Wirtschaftsleben (Produktion, Konsum).
1. Im Geistesleben soll Freiheit herrschen, sodass sich individuelle Fähigkeiten und spirituelle Erkenntnisse ungehindert entfalten können. Dies könnte dem antisozialen Trieb im Denken entgegenwirken, indem nicht belehrt, sondern zur freien Erkenntnis angeregt wird. Dazu muss Ich mir selbst und jedem anderen Menschen eine eigene Erkenntnisfähigkeit zutrauen.
2. Im Rechtsleben soll der Grundsatz der Gleichheit gelten. Dies kann dem antisozialen Trieb im Fühlen entgegenwirken, indem jeder Mensch in seiner Individualität respektiert und nicht nach subjektiven Vorstellungen geformt werden soll. Dazu muss Ich mir klar machen, dass jeder Mensch ein mit besonderen Fähigkeiten begabtes individuelles Wesen ist, und das jede individuelle Fähigkeit für das Gelingen der Weltgesellschaft wichtig ist – paradoxerweise liegt die Gleichheit gerade in der Unterschiedlichkeit, der Individualität der Menschen.
3. Im Wirtschaftsleben soll das Prinzip der Brüderlichkeit vorherrschen, wobei die Bedürfnisse der anderen Menschen im Vordergrund stehen und die Zusammenarbeit auf Kooperation und Gemeinwohl gerichtet ist. Im arbeitsteiligen Wirtschaftsleben ist es immer so, dass der Einzelne für andere sorgt, während alle anderen für den Einzelnen sorgen. Niemand versorgt sich selbst, sondern man wird immer fremdversorgt. Das ist nur möglich, weil alle ihre Fähigkeiten in die gemeinsame Produktion einbringen, um alle die vielfältigen Waren herzustellen, die die anderen konsumieren. Ein Verständnis dieses weltwirtschaftlichen Zusammenhangs kann dem antisozialen Trieb im Wollen entgegenwirken, denn dann muss das eigene Handeln nicht primär auf den Eigennutz ausgerichtet sein, sondern auf die Bedürfnisse anderer.
Es muss jedoch betont werden, dass diese Dreigliederung bisher kaum verstanden und umgesetzt wurde. Die Schwierigkeit liegt darin, dass das einseitige materialistische und naturwissenschaftliche Welt- und Menschenbild eine solche Betrachtung kaum zulässt. Die Zunahme des Antisozialen fordert jedoch die Notwendigkeit dieser Differenzierung immer weiter heraus.
Die Verdrehung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
In der gegenwärtigen Situation herrscht eine verdrehte Form von Freiheit im Wirtschaftsleben. Man hat die Vorstellung, Freiheit würde bedeuten, man könne alles tun, was einem persönlich von Nutzen ist – wovon man profitiert. Dabei wird nicht gern darauf geschaut, wie man dadurch anderen schadet und wie Mensch und Natur ausgebeutet werden. Da fehlt die Brüderlichkeit, die Perspektive auf den anderen und das Ganze. Im Geistesleben herrscht dagegen, statt der Freiheit, eher die Gleichheit. Vorstellungen von wissenschaftlichem Konsens, Expertengläubigkeit und ideologische Verfestigung führen zu einer Form der Gleichmacherei. Der Individualismus, die eigene freie und kreative Erkenntnis, gehen verloren. Das Rechtsleben steht leidend zwischen diesen verdrehten Verhältnissen und expandiert deshalb ungehemmt. Die wachsende Flut an Gesetzen und Kontrollen ist ein Symptom eines, aufgrund verdrehter Begriffe, erkrankten sozialen Organismus.
In solchen Krisenzeiten wäre die »Dreigliederung« eine notwendige Orientierung, da sie einen Weg aufzeigen könnte, die Fehlentwicklungen in den verschiedenen Bereichen zu korrigieren. Eine Wirtschaft, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert statt am Profit Einzelner, ein Rechtsleben, das auf echter Gleichheit und Dialog basiert, und ein Geistesleben, das von Freiheit und Individualismus geprägt ist, können gemeinsam dazu beitragen, soziale Spannungen und Krisen zu mindern. Ein gesundes soziales Leben benötigt eine bedürfnisorientierte Wirtschaft, ein dialogorientiertes Rechtsleben und ein freies Geistesleben.
Das menschheitliche Denken
Ein weiterer wichtiger sozialer Impuls wäre das »menschheitliche Denken«. Dies bedeutet, bei allen Handlungen und Entscheidungen nicht nur das Persönliche oder eine bestimmte Gruppe im Blick zu haben, sondern die gesamte Menschheit als großen Organismus zu berücksichtigen.
Menschheitliches Denken erfordert, die eigenen Grenzen zu überwinden und sich als Teil eines größeren Ganzen zu verstehen. Es steht im Gegensatz zu egoistischen oder sektiererischen Tendenzen und kann dazu beitragen, die aus den antisozialen Trieben resultierenden Konflikte auf einer höheren Ebene zu lösen, indem das Wohl der Gemeinschaft und der gesamten Menschheit in den Vordergrund tritt.
Fazit
Die Überwindung der antisozialen Triebe und die Gestaltung eines gesunden sozialen Lebens ist ein komplexer Prozess, der das Verständnis und die Umsetzung der Dreigliederung, ein auf die gesamte Menschheit ausgerichtetes Denken sowie den unermüdlichen Einsatz für die Freiheit erfordert. Im Alltag kann jeder bei sich selbst anfangen, indem er die drei antisozialen Triebe bei sich reflektiert und so oft es geht versucht, einen entsprechenden Gegenimpuls zu setzen.
Quellen
»Was ist der Anthroposophische Sozialimpuls«
Vortrag Dr. Michaela Glöckler in Wien am 26.5.2018
https://youtu.be/7Ut9fnp_GHs?si=dCCkQS0ywZI6l0mf