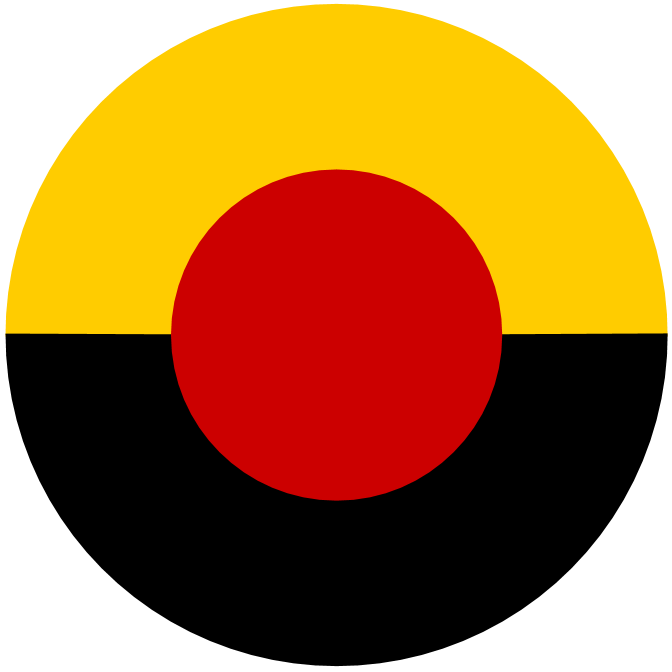Geld durchdringt unser alltägliches Leben, vom Größten bis ins Kleinste. Es beherrscht das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben. Dennoch wird die Frage, was Geld ist, selten gestellt. Was Geld im wesentlichen ist, bleibt im unbewussten. Stattdessen bestimmen unhinterfragte Stereotype unser Denken und Handeln im Umgang mit Geld.

Die Frage nach dem Geld ist entscheidend
Die meisten Menschen haben tagtäglich mit Geld zu tun. Überlegungen und Berechnungen darüber wie man sein Geld verdient und wie man sein Geld ausgibt, ziehen sich bis in die kleinsten Alltagshandlungen hinein. Oft bindet das Ringen um das Geld eine Menge körperlicher und seelischer Kräfte. Die meisten »kleinen Leute«, aber auch die Wirtschaftsbosse, Wirtschaftswissenschaftler und Politiker kämpfen damit, dass das Geld knapp ist – sogar Millionäre und Milliardäre haben Not, dass es ihnen nicht irgendwann knapp wird. So beherrscht das Geld wie selbstverständlich das Wirtschaftsleben und damit auch das gesellschaftliche Leben. Viele haben das auch schon gemerkt und denken sich insgeheim oder ganz offen: »Geld regiert die Welt«.
Trotz dieser Allgegenwart und Allmacht des Geldes und den damit verbundenen Schwierigkeiten, wird aber das Geld selbst selten bis nie in Frage gestellt. Wichtigen Fragen wird ausgewichen. Diese Fragen sind: Was ist Geld? Wie wird das Geld hergestellt, also geschöpft? Warum müssen wir alle ständig Geld verdienen? Warum haben die meisten Leute zu wenig Geld und einige wenige Leute sehr viel Geld?
Wenn diese Fragen auftauchen, kann man sich schlecht auf die Position zurückziehen, dass man mit Geld nichts zu tun habe – oder das es zu kompliziert wäre, diese Fragen zu klären. Denn, jeder Mensch hat mit Geld und seinen Auswirkungen im Sozialen zu tun, da jeder Mensch konsumierend und produzierend am sozialen Leben und damit auch am Wirtschaftsleben teilnimmt. Alles – im Kleinen und im Großen – wird irgendwie vom Geld beherrscht. Deshalb müsste sich jeder, der es mit der Zukunft, der Freiheit und der Demokratie ernst meint, diesen Fragen nach dem Geld ernsthaft stellen.
Vor der Lösung muss das Geld
von Stereotypen befreit werden
Die Frage nach dem Geld zum Tabu zu machen und im unbewussten zu belassen, wäre naiv und fahrlässig. Das nämlich mit dem Geld etwas nicht stimmt, und das bei allen gesellschaftlichen Verwerfungen, Krisen und Kriegen das Geld eine Rolle spielt, wird immer deutlicher sichtbar. Allen Bemühungen um eine gerechtere und bessere Zukunft, stehen die herrschenden Geld-Stereotype im Wege.
Mit Geld-Stereotyp meine ich feststehende, unveränderliche, ständig wiederkehrende, in der Form erstarrte, leere, langweilige und vor allem unreflektierte Vorstellungen über das Geld. Und das es mit dem Geld, dem Wohlstand, dem Sozialen, der Demokratie, der Freiheit und dem Frieden nicht klappt, liegt daran dass die verbreiteten Vorstellungen vom Geld unvollständig bis falsch sind. Diese Vorstellungen sind so verdreht, dass sie den gesellschaftlichen Idealen entgegenstehen.
Die Lösung der Geldfrage erfordert deshalb zunächst zu verstehen, mit welchen Vorstellungen wir es zu tun haben. Bevor wir uns einer möglichen Lösung zuwenden und das »freie Geld« und die »kreative Weltwirtschaft« beschreiben, muss zunächst das Problem in Form der vier Geld-Stereotype erkannt werden.
Die vier Geld-Stereotype sind:
- Geld ist ein Tauschmittel – wobei man meint Wirtschaft würde mit banalen direkten Tauschgeschäften funktionieren.
- Geld ist Gold – wobei man meint, der Wert des Geldes müsse durch materielle Dinge gedeckt sein oder Geld sei sogar selbst ein Wert.
- Geld verdient Geld – wobei man meint, man könne sein Geld für sich arbeiten lassen und so Zinsen verdienen.
- Geld regiert die Welt – wobei man meint, dass reiche Eliten die Welt beherrschen und dabei nicht merkt, dass es das eigene Denken über Geld ist, was hier herrscht.
1. Geld ist (k)ein Tauschmittel
Das erste Stereotyp ist die Vorstellung vom Geld als Tauschmittel. Es ist richtig, dass eine Funktion des Geldes die des Tauschmittels ist. Was aber mit dem Begriff des Tauschmittels schnell verbunden wird, ist die naive Vorstellung von einer Wirtschaft die aus direkten Tauschprozessen besteht. Diese Vorstellung ist naiv, weil ein privater Tauschhandel zwischen zwei Personen zwar im Rahmen einer Haus- oder Dorfwirtschaft leicht vorstellbar ist – aber er ist trotzdem relativ unmöglich und stark begrenzt.
Die Wahrscheinlichkeit das zwei Personen mit zwei Produkten die jeweils das Bedürfnis des anderen erfüllen und die von gleichem Wert sind am gleichen Ort und zur gleichen Zeit zusammenkommen, ist sehr gering. Der Aufwand den richtigen Tauschpartner zu finden wäre so hoch, dass es günstiger wäre, die Produkte selbst herzustellen. Eine Wirtschaft, die auf direkten Tauschgeschäften beruht, würde nicht über das Niveau einer Selbstversorger- und Kleinwirtschaft hinauskommen. Es steht auch in Frage, ob es diese Art des Tauschhandels je gegeben hat.
Eine moderne industrialisierte Weltwirtschaft, die das Niveau an Fortschritt, Freiheit und Wohlstand schafft, dass wir für die Zukunft brauchen, ist erst durch das Geld möglich – wobei es eben nicht mehr um das private Tauschen und den persönlichen Vorteil geht. Sondern es geht um den Austausch zwischen dem einzelnen mit Fähigkeiten begabten Menschen und dem Sozialen Ganzen. Der einzelne Mensch gibt seine Leistung in den gesamten Wirtschaftsraum hinein und erhält dafür das Geld als Symbol für seine Leistung. Das Geld-Symbol ermöglicht ihm, an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, von einer ganz anderen Person eine ganz andere Leistung zu aus dem Ganzen des Wirtschaftslebens zu beziehen und darüber frei zu entscheiden. Das Geld hebt also die Begrenzungen des direkten Tauschens auf.
2. Geld ist (kein) Gold
Das zweite Stereotyp ist die Vorstellung, dass das Geld mit dem wir täglich in Form von Münzen, Scheinen oder Zahlen in Computern umgehen, in irgendeiner Weise durch Gold, andere Edelmetalle oder andere materielle Dinge gedeckt sein müsse. Tatsächlich ist es so, dass das Geld bereits seit über 100 Jahren als Zahl in einer doppelten Buchführung geschöpft wird. Diese Buchgeldschöpfung »aus dem Nichts« können die Zentral- und Geschäftsbanken durch Kreditvergabe auslösen. Dazu müssen kein Gold oder die Spareinlagen anderer Bankkunden in den Tresoren liegen.
Diese Art der Geldschöpfung und die Idee der doppelten Buchführung, müsste von jedem der Geld benutzt, verstanden werden. In der modernen Weltwirtschaft geht es nämlich darum, dass Menschen ihre Fähigkeiten entwickeln und zum Wohle aller verwirklichen können. Fähigkeiten sind etwas das Menschen aus ihrem geistig-kreativen Inneren hervorbringen. Das geistige im Sinne von Kreativität und Spiritualität ist nicht materiell begrenzt. Deshalb sind Fähigkeiten unbegrenzt. Es wäre widersinnig dieses unbegrenzte Kreativitäts-Potenzial des Menschen, durch ein auf Materie begrenztes Geld zu behindern. Erst die Buchgeldschöpfung ermöglicht es, in Beziehung auf die menschlichen Fähigkeiten, unbegrenzt Geld zu schöpfen und damit unbegrenzt kreatives, geistiges Potenzial zu verwirklichen.
3. Geld verdient (kein) Geld
Das dritte Stereotyp ist die Vorstellung, dass man mit Geld Geld verdienen könnte, indem man sein Geld gegen Zinsen verleiht oder »investiert«. Der Zins ist dabei – wie das Geld selbst – einer dieser unhinterfragten Begriffe, die alltäglich hingenommen werden, als seien sie von der Natur oder von Gott gegeben.
Wenn ich den Zins aber genauer beleuchte, wird deutlich, dass er einige Schwierigkeiten mit sich bringt:
Der Zins erzeugt Abhängigkeiten und Machtgefälle zwischen Gläubigern und Schuldnern.
Der Zins führt dazu, dass das Geld, das im Wirtschaftsleben frei fließen müsste, um seine Aufgabe zu erfüllen, immer wieder zurückgehalten, gestaut und festgelegt wird.
Der Zins führt dazu, dass die Geldbesitzer die Entscheidungsmacht über Fragen haben, die eigentlich demokratisch beschlossen werden müssten.
Der Zins auf Zinsen führt zu exponentiellen Wachstumsraten, durch die sich das bestehende Geldsystem von der Realität entkoppelt.
Vor allem aber führt der Zins zu der Illusion, dass man sein Geld für sich arbeiten lassen könnte. Dass man also »passiv«, ohne selbst etwas dafür zu tun, Geld verdienen könnte. Das Problem ist dabei, dass Geld nicht arbeitet, sondern nur Menschen arbeiten. Zinsen aus der Arbeit anderer Menschen zu beziehen, ist Ausbeutung. Wenn das alle machen – und heutzutage machen das alle, in größerem und kleinerem Ausmaß – dann beuten sich alle gegenseitig aus. Am Ende gehören auch die zu den Verlierern, die jetzt noch ihr Geld für sich arbeiten lassen.
Diejenigen die unter der Wahnvorstellung leiden, man könne sein Geld für sich arbeiten lassen, müssen sich klar machen, dass diese Art des egoistischen Denkens und Handelns sich letztendlich gegen sie selbst richtet – es ist Selbstzerstörung. Deshalb müsste man schon aus purem Egoismus endlich damit aufhören.
4. Geld regiert die Welt
Das vierte Stereotyp ist die Vorstellung, dass das Geld die Welt regiert. Betrachtet man die ungleiche Verteilung von Schulden und Vermögen kann man tatsächlich zu diesem Schluss kommen. Im Zusammenhang mit indirekten Zinsen und dem Zinseszins-Mechanismus wird außerdem deutlich, dass das Geld immer schneller und weiter von den vielen die fleißig für ihr Geld arbeiten, zu den wenigen, die ihr Geld (also andere Menschen) arbeiten lassen, umverteilt wird. An zahlreichen Zahlen, Daten und Statistiken wird deutlich, dass über 90% der Menschen die Verlierer in diesem Zinseszins-Spiel sind, und das auch die Rückwärts-Umverteilung durch Steuern oder Transferleistungen aussichtslos ist.
Die Tatsachen bestätigen, dass das herrschende Geldsystem, und die wenigen die in diesem System an der Spitze stehen, die Welt regieren. Dieses unmenschliche System ist aber nur möglich, weil die meisten Menschen dieses System ständig stärken und reproduzieren, weil sie selbst ihre Geld-Stereotype und das damit verbundene asoziale Verhalten ständig wiederholen.
Das bedeutet, die Lösung kann keine Revolution oder ein anderes System im Außen sein. Die Lösung liegt im Denken und in den Begriffen. Erstmal muss das System raus aus uns, es muss raus aus den Köpfen, indem wir die bestehenden stereotypen Begriffe aufklären. Dann geht es daran neue Ideen und zukunftsfähige Begriffe vom Geld, von der Wirtschaft und damit auch von der Arbeit und den Unternehmen zu entwickeln.
Wir müssen nicht raus aus dem System,
sondern das System muss raus aus uns
Geld wird also oft als banales Tauschmittel verstanden, obwohl es weit darüber hinausgeht. Man stellt sich vor, Geld sei durch Gold oder andere materielle »Werte« gedeckt, obwohl es längst grenzenlos »aus dem Nichts« durch Buchgeldschöpfung entsteht. Die Illusion, dass man durch Zinsen sein Geld für sich arbeiten lassen kann, verdrängt die Tatsache, dass nur Menschen arbeiten, die durch den Zins ausgebeutet werden. Und schließlich führt die ständige Wiederholung dieser unreflektierten Geld-Stereotype dazu, dass das System »Geld regiert die Welt«, von jedem Einzelnen gestärkt und erhalten wird, obwohl derselbe einzelne Mensch darunter leidet.
Die Kritik am bestehenden Geldsystem sollte sich deshalb auf dessen Struktur statt auf persönliche Schuldzuweisungen konzentrieren. Das System wird durch gesellschaftlich verankerte Geld-Stereotype stabilisiert, die grundlegende Fragen über Geld und seine Rolle vermeiden. Statt das System von außen zu bekämpfen, muss es aus den Köpfen der Menschen verschwinden. Ziel ist ein neues Verständnis von Geld, Arbeit und Wirtschaft, das auf Kooperation, Verantwortung und Freiheit basiert. Geld soll ein Mittel sein, dass frei zwischen Produktion und Konsumtion durch den Wirtschaftsorganismus fließt. Geld soll ein Mittel sein, dass Unternehmen ermöglicht, zu Orten der Kreativität, der Zukunftsgestaltung, der Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung zu werden. Dieser Wandel erfordert keine äußere Revolution, sondern ein neues Denken und eine innere Transformation der Begriffe.
Der Freiheitsprozess ist ein differenziert ausgearbeitetes Modell und eine Lernmethode, um diese Begriffsarbeit zeilstrebig zu bewältigen. Der Freiheitsprozess zum Thema »Geld-Transformation« erklärt genau, wie das »freie Geld« und die »kreative Weltwirtschaft« verstanden werden können und wie wir gemeinsam zu einem zukunftsfähigen Wirtschaftsdenken kommen, um uns von den bestehenden Geld-Stereotypen und damit aus dem Schlamassel zu befreien.